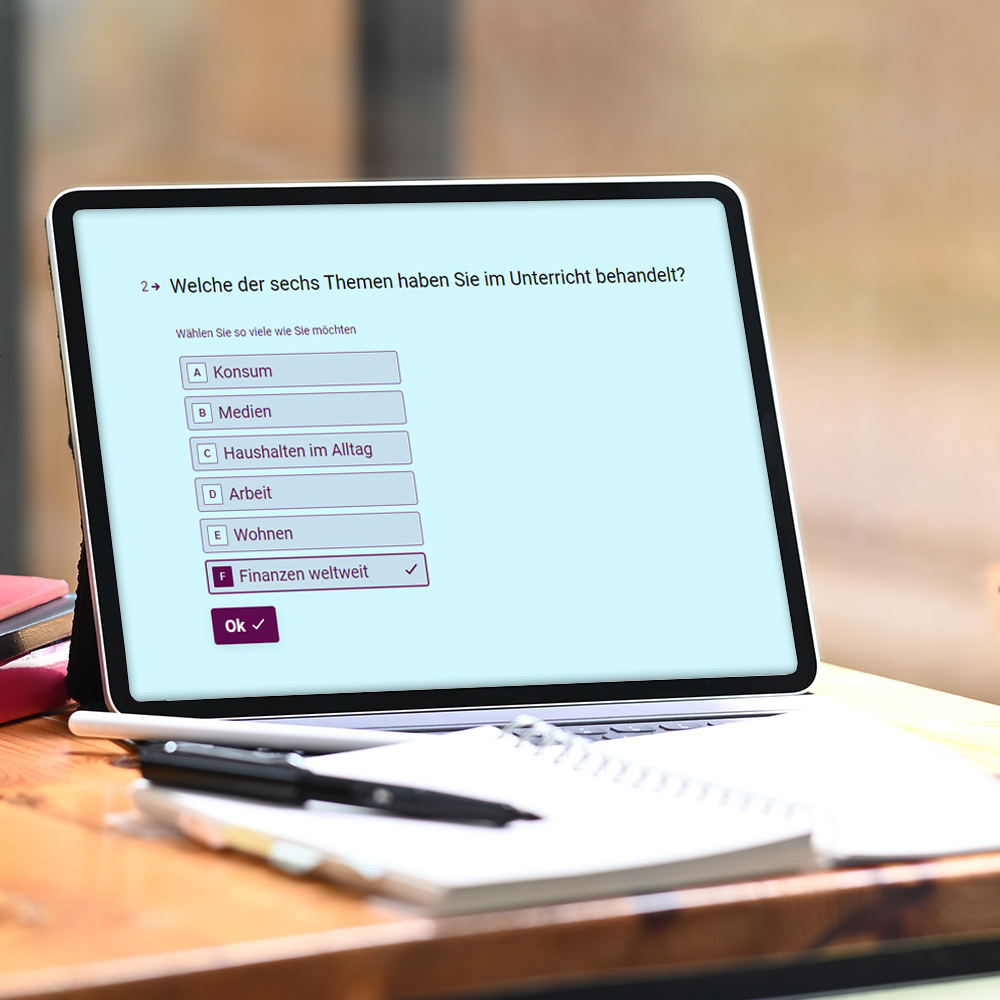Inflation, was tun?
Wenn sich die Preise „aufblähen“
Stellen Sie sich vor, sie benötigten eine Schubkarre voller Geldscheine, um ihren Tageseinkauf zu erledigen. Sie halten das für undenkbar? 1923 stiegen die Preise in Deutschland in kurzer Zeit so stark, dass dies tatsächlich nötig war. Damals heizten viele Menschen sogar ihren Ofen mit Geld, weil das günstiger war, als Kohle zu kaufen. Doch wir müssen gar nicht so weit in die Vergangenheit blicken. In Venezuela hat die Landeswährung Bolivar 2018 so stark an Wert verloren, dass sogar Taschen und Kleidungsstücke aus den Geldscheinen genäht wurden.

Wenn alles teurer wird beziehungsweise das Geld seinen Wert verliert, dann spricht man von Inflation. In den letzten Jahren ist die Inflationsrate in Deutschland stark gestiegen – zeitweise lag sie bei über 8 Prozent. Zwar hat sich die Rate inzwischen wieder etwas abgeschwächt, doch die Preise für viele Produkte des täglichen Lebens sind seit 2024 weiter gestiegen. Besonders deutlich wird das im Supermarkt oder beim Essen unterwegs: Ein Döner, der 2019 noch etwa 3,50 € kostete, liegt 2025 bei rund 8 €. Auch Butter, Milchprodukte, Brot und Gemüse sind heute deutlich teurer als noch vor wenigen Jahren.
Die Gründe sind vielfältig: Höhere Produktionskosten durch gestiegene Energie- und Transportpreise, teurere Rohstoffe wie Weizen, Milch oder Öl, aber auch Extremwetter in Südeuropa, das zu Ernteausfällen führt. Zusätzlich schlagen höhere Löhne, Versicherungen und Reparaturkosten für Betriebe auf die Endpreise durch. All diese Faktoren führen dazu, dass das Geld an Wert verliert – für denselben Betrag bekommt man heute weniger Ware als noch vor wenigen Jahren.
Die Preise steigen aber nicht einfach ohne Kontrolle. In Europa trägt die Europäische Zentralbank (EZB) die Verantwortung dafür, dass die Inflation nicht zu hoch wird. Ihr Ziel ist, dass die Preise im Durchschnitt nur etwa 2 Prozent pro Jahr steigen. Weil die Inflation in den letzten Jahren jedoch deutlich darüber lag, hat die EZB den sogenannten Leitzins erhöht. Das bedeutet: Kredite und Darlehen werden teurer, sodass weniger Menschen und Firmen Geld ausgeben. Auf diese Weise versucht die EZB, die Nachfrage zu verringern und die Preise wieder zu stabilisieren.
Einer Inflation können Verbraucher*innen nicht ausweichen. Aber es gibt Handlungsmöglichkeiten im Alltag: Preise vergleichen, bewusst einkaufen, auf günstigere Alternativen zurückgreifen und Ressourcen sparsamer nutzen. Da Kinder die Diskussionen über steigende Preise miterleben, ist es wichtig, mit ihnen ins Gespräch zu kommen und ein Verständnis dafür zu schaffen. Denn die Inflation und ihre Folgen werden unseren Alltag voraussichtlich noch länger begleiten.